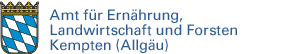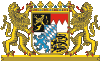Moore sind gut für das Klima und die Artenvielfalt. Wälder auch. Doch wie funktionieren Moor und Wald gemeinsam und kann so ein Moorwald auch wirtschaftlichen Ertrag bringen?
Diesen Fragen gingen rund 30 Teilnehmende bei einem Waldbegang bei Oy-Mittelberg nach, den die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) Kempten und Kaufbeuren gemeinsam mit der Fachstelle Waldnaturschutz und der Allgäuer Moorallianz veranstaltet haben. An drei Stationen boten Fachleute Einblicke in Forstwirtschaft und Naturschutz, demonstrierten spezielle Maschinen und Techniken für den Moorwald.
Mit einer kleinen Zeitreise begann Boris Mittermeier von der Fachstelle Waldnaturschutz den Schulungsabend: „Die Geschichte unserer Moore beginnt mit dem Ende der letzten Eiszeit.“ Mithilfe von anschaulichen Plakaten skizzierte er die Entstehung der Hoch- und Niedermoore, ihre Besonderheiten und stellte Pflanzen vor, die anzeigen, dass man sich im Moor befindet. Torfmoose, Rauschbeeren oder der Bärlapp seien beispielsweise in unseren Mooren zuhause.
Revierförster Thomas Schneid machte anhand von mit Bohrstöcken entnommenen Bodenproben sichtbar, wie es unter der moosigen Oberfläche aussieht. Die Bodenproben ordneten die Förster verschiedenen Bodentypen in der Umgebung zu. Anhand der sogenannten „Standortkarten“ der Bayerischen Forstverwaltung konnte die Gruppe analysieren, welche Baumarten für den jeweiligen Boden geeignet sein könnten. „Wir wollen Bäume pflanzen, die auch in Zukunft noch stabil dastehen“, so Schneid. Was in Zeiten der Klimaerwärmung für jeden Waldbesitzenden eine Herausforderung ist, gilt für Besitzer von Moorwäldern ganz besonders. Denn je weicher der Boden, umso besser muss ein Wald gepflegt werden.
Auch die Waldpflege stellt sich an nassen Standorten kompliziert dar: Gängige Forstmaschinen sind für Moorböden zu schwer, Rückepferde sinken schnell ein, die Seilkranbringung ist teuer und aufwändig. An der zweiten Station präsentierten deshalb die Forstunternehmer Bernd Schultes und Manuel Wörz zwei besondere Maschinen: Das „Iron Horse“, eine mit einem Meter Breite und einer knappen Tonne Gewicht verhältnismäßig handliche Maschine zur Holzrückung, und eine ferngesteuerte Forstraupe, die neben der Rückung auch zum Mulchen eingesetzt werden kann. Bei einer praktischen Vorführung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die bodenschonenden Maschinen bei ihrer Arbeit sehen.
Zwar ist die Bewirtschaftung von Moorwäldern aufwändig und der Holzertrag vergleichsweise gering. Doch sie haben enormen Wert für Natur und Klima. Aus dem Grund gibt es spezielle Fördermöglichkeiten im Moorwald, die die Förster bei der Schulung darlegten: Für die Schaffung lichter Waldstrukturen mit Nutzungsverzicht sowie für den Erhalt von Biotopbäumen und das Belassen von Totholz im Wald gibt es im Rahmen des Vertragsnaturschutzprogramms Wald bares Geld pro Hektar beziehungsweise pro Baum. Die Försterinnen und Förster der ÄELF beraten interessierte Waldbesitzer dazu.
Die dritte Station schließlich befand sich auf einem Wanderweg im Seemoos. Carmen Scherbaum stellte hier die Arbeit der Allgäuer Moorallianz vor. Am Beispiel des Seemooses schilderte sie den Weg der Projektgebiete vom einst entwässerten, durch Torfabbau beeinträchtigten Moor hin zum als Naherholungsgebiet beliebten Kleinod der Artenvielfalt. Die Chancen stünden gut, so Scherbaum, dass das Seemoos sich durch die Wiedervernässung und die begleitenden Naturschutzmaßnahmen zu einem torfbildenden Hochmoor zurückentwickeln könne. Damit wird nicht nur der Klimaschutz vorangetrieben – auch sehr seltene hochmoortypische Tier- und Pflanzenarten haben durch das Projekt überlebt oder sind wieder eingewandert.
Scherbaum, Schneid und Mittermeier zeigten bei diesem Waldbegang auf, wie Waldnutzung und Naturschutz Hand in Hand gehen können und wie Moorwälder vielfachen Nutzen haben können – für ihre Besitzer, vor allem aber auch für den Natur- und Klimaschutz.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden