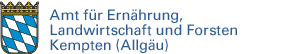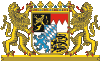Mitte März 2025 veranstaltete das Netzwerk Fokus Tierwohl der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten einen Workshop zum Thema „Kuhsignale“.
Die Organisatorinnen, Petra Siman von der LfL und Svenja Heinen vom AELF begrüßten die Teilnehmenden zunächst in den Räumen des AELF Kempten. Am Vormittag gab Wolfgang Müller, Leiter des Bildungs- und Versuchszentrums für Rinderhaltung und Berglandwirtschaft, Spitalhof Kempten sowie zertifizierter KuhSignal-Trainer, zunächst theoretische Einblicke in die Bedeutung der Kuhsignale, bevor die Teilnehmenden am Nachmittag praktische Erfahrungen am Spitalhof sammeln konnten.
Landwirte mit Wissen um wichtige Kuhsignale könnten die Nutzungsdauer und Tiergesundheit der Kühe verbessern, so Müller. Dies komme nicht nur den Tieren zugute, sondern sei auch wirtschaftlich sinnvoll für die Landwirte und steigere die Freude an der Arbeit.
Ein zentraler Aspekt der Schulung war die Frage: „Was will die Kuh?“ Um möglichst großes Tierwohl zu erreichen, müssen die Grundbedürfnisse der Kühe wie Futter, Wasser, Licht, Luft, Ruhe und Raum, erfüllt werden. Dies erfordert richtiges Management, aber auch Zeit und Aufmerksamkeit, um die Kühe zu beobachten und ihre Bedürfnisse zu erkennen. Ausreichend Arbeitskräfte - mindestens eine Arbeitskraft pro 50 Tiere - sind daher ein Faktor für Tierwohl.
Besonders betonte Müller die Bedeutung von Liegeboxen, da Kühe im Liegen arbeiten: „Wenn das Liegen nicht gescheit funktioniert, dann arbeitet die Kuh ihr ganzes Leben lang schlecht.“ Auch Überbelegung im Stall sei ein Stressor, der die Energiereserven der Kühe aufbrauche und somit negative Auswirkungen auf Milchleistung, Immunabwehr und Fruchtbarkeit habe. Die Teilnehmer lernten, dass Kühe durch verschiedene Körperanzeichen, wie Technopathien, die Hungergrube oder den Füllungsgrad des Pansens, ihren Zustand anzeigen. Landwirte sollten stets mit allen Sinnen arbeiten, betonte Müller: Sehen, Riechen, Hören und Fühlen. Und dabei stehts auch nach den Ursachen für entdeckte Anzeichen suchen.
Die Arbeit mit allen Sinnen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann am Nachmittag im Spitalhof einüben. Sie erhielten eine Checkliste, die sie durch den Beobachtungsprozess führte. Zunächst sollten sie die Herde ruhig vom Futtertisch aus beobachten, um die Verteilung zu bestimmen, gefolgt von einer sensorischen Kontrolle des Einstreumaterials und der Einzeltierbeobachtung. Um eine gute Portion Wissen und Erfahrungen reicher beendeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Tag – und können die Signale ihrer Tiere künftig noch besser interpretieren.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden